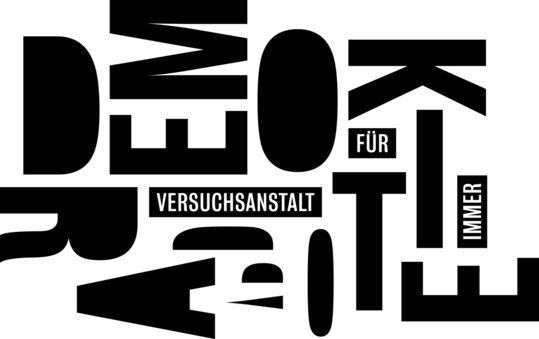MUSIK FÜR ALLE - Ein Abend voller Vielfalt
Lesezeit: ca. 7 Minuten
Am 4. Juni lud WUK Musik gemeinsam mit mica – music austria zum ersten „Demokratie am Tisch“-Event in den WUK Hof. Musik ist ein Menschenrecht, ein Mittel der persönlichen Entfaltung, des gemeinschaftlichen Erlebens und Agierens. Doch nicht alle Menschen haben den gleichen Zugang dazu – sei es beim Musizieren, beim Konzertbesuch oder in der Ausbildung. Der Abend brachte Menschen an einen Tisch – im wahrsten Sinn. Publikum, Künstler*innen und Organisator*innen begegneten sich auf Augenhöhe, bei Essen, Gesprächen und künstlerischen Beiträgen.

Auf einer Fahne im Hof des WUK steht in Großbuchstaben: „FullAccess“. Die Sonne glitzert über die Dächer und taucht den Hof in warmes Licht. Schön gedeckte Tische mit weißen Tischtüchern und roten Blumen laden zum Verweilen ein. Oben auf den großen Holzstiegen übt bereits eine Person an der Bassgitarre – die Saiten vibrieren im Rhythmus des Moments. Auf einer metallenen Wand sind die Worte „Musik für alle. Welche Barrieren beschäftigen dich?“ zu lesen. Besucher*innen sind eingeladen, ihre Gedanken auf bunten Post-its zu hinterlassen. Die Antworten sind interessant: Zugänglichkeit, Bezahlbarkeit – ein Kommentar sticht hervor: „Tod dem Algorithmus“, eine humorvolle Anspielung auf digitale Herausforderungen.
Der Abend beginnt: Sphärische Gitarrentöne schweben durch die Luft. Vera Rosner und DanceAbility-Performer*innen bewegen sich – mit und ohne Rollstuhl und Krücken – im Rhythmus der Musik. Tiefe Blicke, Berührungen und Tanz. Neben dem Geschehen auf dem Boden zeichnen sich ihre Bewegungen in der Peripherie ab – auf den Balkonen des Gebäudes finden wir die Tänzer*innen wieder. Ein Mensch mit gelbem Regenschirm erscheint auf einem Balkon. Er trägt einen Hut und ein bordeauxrotes Jacket. Er beobachtet zunächst das Geschehen, bevor er zu tanzen beginnt. Der Schirm aus dem quallenartige Fäden herunter hängen, scheint ein Eigenleben zu haben. Er tanzt zu der Willkür des Schirms, in futuristischen, digital-ambienten Klängen.
Ein weiterer Moment: Der Tanz setzt sich entlang der gezeichneten Linie fort. Langsam und bewusst bewegen sich die Peformer*innen im Einklang mit der Musik, drehen die Räder ihrer Rollstühle, klimmen die Holzstiegen empor – eine choreografische Inszenierung aus Modern Dance und Contact Improvisation, die sichtbare Barrieren im Tanz zerfließen lässt. Oben angekommen, wird der Auftakt der Veranstaltung groß bejubelt.
Als Teil des Demokratie Jahresschwerpunkts im WUK verdeutlichte das Event „Musik für alle“ im Rahmen der Reihe „Demokratie am Tisch“, wie facettenreich und herausfordernd die Themen Barrierefreiheit und Inklusion im Kulturbereich sind. Die Gründer*innen von FullAccess boten Einblicke in die organisatorische Umsetzung barrierearmer Events, sowie gesellschaftliche Fragen rund um Behinderung: Wie geht unsere Gesellschaft mit Menschen mit Behinderung um? Und wie sprechen wir über Behinderung? Hier ging es um offene, ehrliche Gespräche – jenseits politischer Korrektheit – um echte Begegnungen und gegenseitiges Verständnis, bei köstlichem Essen in geselliger Runde zu Tisch. Das Publikum, bestehend aus Besucher*innen, Veranstalter*innen, Künstler*innen, Mitarbeitenden und Teilnehmenden von WUK work.space, sowie Mitarbeitenden der Musikschule DoReMi und Ö-Ticket, nahmen teil, um den Horizont über das Thema Inklusion und Diversität zu erweitern.
Die Expert*innen für Accessibility und Diversität von FullAccess, Martina Gollner und Christina Riedler, führten die Besucher*innen hinter die Kulissen. Sie erklärten die Bedeutung kontrastreicher Kleidung für sehbehinderte Menschen, zeigten, wie Events barrierearm gestaltet werden können, und regten zum Nachdenken über gesellschaftliche Normen und nachhaltiges, inklusives Handeln an.
Eine Inspiration: das Sonisphere-Festival in London 2014. Dort wurde Inklusion als fester Bestandteil des Feierns gelebt – ganz unspektakulär und ohne Unannehmlichkeiten. „Wir sind alle hier, für diesen Moment, für den Gig und unterscheiden uns nicht.“ – Ein Gefühl, das zum Leitmotiv werden soll. FullAccess berät Veranstalter*innen, unterstützt diversitätssensible Kommunikation und hilft Künstler*innen, ihre Botschaften inklusiv zu präsentieren. Ziel ist es, Räume zu schaffen, in denen sich alle eingeladen, gesehen und wertgeschätzt fühlen – in Konzertsälen, Museen, Sportstätten, Konferenzräumen und vielem mehr.

Was bedeutet es, behindert zu sein? Ist es eine medizinische Diagnose, gesellschaftliche Zuschreibung oder kulturelle Konstruktion?
Laut § 3 des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz ist „Behinderung... die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu erschweren... mehr als voraussichtlich sechs Monate.“
Martina Gollner und Christina Riedler erläuterten in ihrem Input verschiedene Modelle der Behinderung, die unsere Sichtweisen maßgeblich prägen: Das medizinische Modell, das Behinderung als individuelles Problem betrachtet, das behandelt und überwunden werden muss. Das soziale Modell, das hingegen die Gesellschaft in die Verantwortung nimmt, Barrieren abzubauen, um echte Teilhabe zu ermöglichen. Und das kulturelle Modell, das gesellschaftliche Wahrnehmungen und Normen über Körperbilder und Behinderung hinterfragt und diese im Wandel der Zeit betrachtet. Begriffe wie „Integration“, „Inklusion“ und „Diversity“ sind jeweils mit diesen Modellen verbunden und spiegeln unterschiedliche Ansätze wider.
Die Realität ist komplex: Gesellschaftliche Normen, Machtverhältnisse und strukturelle Mechanismen der Ausgrenzung, beeinflussen den Blick auf Behinderung wesentlich. Die Mehrheitsgesellschaft entscheidet, wer dazugehört und wer ausgeschlossen wird.
Das Zitat „Wir sind nicht behindert, wir werden behindert!“ – durch Barrieren, Vorurteile und unüberlegte Strukturen – bietet ein entscheidendes Bewusstsein für vorherrschende Systeme und regt zum kritischen Hinterfragen dieser an.
Ein grundlegendes Thema war außerdem die richtige Benennung: Statt euphemistischer Umschreibungen wie „Personen mit besonderen Bedürfnissen“ soll die klare Bezeichnung „Menschen mit Behinderung“ genutzt werden – ein rechtlich verankerter Begriff, der die Würde der Betroffenen anerkennt. Es wurde verdeutlicht, dass sichtbare und unsichtbare Behinderungen existieren. Unsichtbare Behinderungen wie Autismus, Neurodivergenz oder weitere psychosoziale Beeinträchtigungen sind oft schwer erkennbar, beeinflussen jedoch ebenso das gesellschaftliche Miteinander. Eine Kennzeichnung für unsichtbare Behinderungen, mit grünem Hintergrund und Sonnenblumen, soll hier Achtsamkeit schaffen.

Über 20 Prozent der Menschen in Österreich leben mit sichtbaren oder unsichtbaren Behinderungen – viele fühlen sich ausgeschlossen, benachteiligt oder übersehen. Obwohl das Gesetz in Österreich Gleichstellung und Barrierefreiheit fordert, ist die Umsetzung in der Praxis, besonders im Freizeitangebot, oft unzureichend. Hier sind mehr als nur inklusive bauliche Maßnahmen notwendig: barrierearme digitale Angebote, Veranstaltungen mit Gebärdensprachdolmetscher*innen, einfache Sprache, Ruheräume, Shuttleservice sowie Areale für Assistenz- und Begleitpersonen sind nur einige ergänzende Maßnahmen auf dem Weg zur echten Barrierefreiheit.
Zum Abschluss der Veranstaltung verteilten die Expert*innen seheinschränkende Simulationsbrillen, um den Besucher*innen die Welt aus einer anderen Wahrnehmung näherzubringen. Mit vielen Impulsen für das weitere Gespräch am Tisch, erfreuten wir uns an den servierten Köstlichkeiten. Es wurde geredet, gedacht und herzlich gelacht.

„Demokratie am Tisch“ hat gezeigt: Inklusion ist kein abstraktes Ziel, sondern ein fortwährender Prozess, der alle betrifft. Kleine Schritte bewirken große Unterschiede – für Menschen mit und ohne Behinderung. Es braucht Offenheit, Entschlossenheit und den festen Willen, Räume zu schaffen, in denen alle Menschen nicht nur akzeptiert, sondern aktiv in ihrem Spektrum an Fähigkeiten wertgeschätzt werden.
Motivierend bleibt die wesentliche Frage: Wie können wir gemeinsam Wege finden, um eine inklusive Gesellschaft und Infrastruktur zu schaffen, in der jede Person in ihrer individuellen Lebensrealität anerkannt und geachtet wird?
Text: Jasmin Behnawa (B.Sc.Psychologie) ist Autorin und Spoken Word Künstlerin. Mit einem intersektionalen Verständnis von Feminismus, setzt sie sich für Menschenrechte, gegen Diskriminierung und systemische Gewalt ein. Neben ihrer Arbeit als visuelle und darstellende Künstlerin, ist sie in psychosozialer Mädchen- und Jugendarbeit tätig, und hat berufliche Erfahrungen in Gewaltschutz und -prävention.
Weitere Termine von „Demokratie am Tisch“
- Mi 1.10.2025, kex – kunsthalle exnergasse und hint.wien: Words on Fire
- Di 21.10.2025, Bildung und Beratung am Tisch
- Sa 22.11.2025, WUK KinderKultur und Nadja Brachvogl: Demokratie im Bauch – das Veto-Prinzip