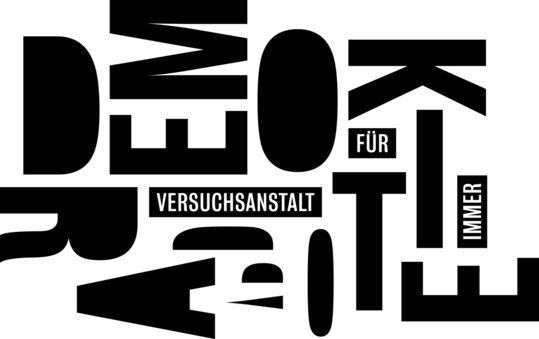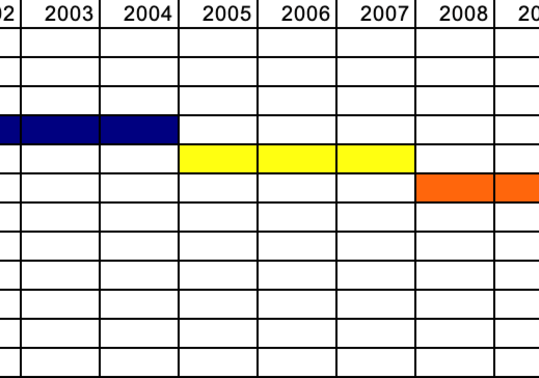building < against
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Gegen die Bau-Wut. Für offene Räume
Kapitalistische Eigentumsverhältnisse erobern im urbanen Raum immer mehr öffentliche und offene Flächen. Wo auch immer sich das Potential zu Aufwertung ausmachen lässt, werden Eigentumsgrenzen verstärkt behauptet und mit der Versprechung auf bessere Wohn- und Konsumbedingungen spekulative Bauprojekte hochgezogen. Durch Abrisse gehen Wohnräume, persönliche Geschichten verloren. „Graue Energie“ – das heißt, die Energie, die zur Errichtung benötigt wird und in den Baustoffen gebunden ist – verpufft dabei. Und schließlich frisst die Bau-Wut Brachen und offene Flächen, die in Städten so dringend nötig wären, um mehr Raum für Begegnung und Gestaltung in Eigeninitiative zu bieten.
Doch Bewohner*innen, selbstorganisierte Initiativen und politische Gruppen bauen ihre eigenen, kleinteiligen Strukturen auf. Sie entwickeln unerwartete Freund*innenschaften, lernen zusammen und voneinander entlang ihrer eigenen Bedürfnisse, ganz ohne Lehrmeister. Offene Räume geben dabei dem widerständigen Potenzial der Menschen und dem Wunsch nach anderen Beziehungsweisen Platz!
Von Einhegung und Abwertung
Es ist kein Zufall, dass Baustellen und Brachflächen nicht einfach offenstehen, sondern meist durch Bauzäune und Holzvertäfelungen verschlossen sind. Passant*innen und Bewohner*innen bleibt dann so nicht einmal der Blick in die leeren Baulücken. Ihnen wird weder die utopische Vorstellung einer anderen Nutzung, noch die erleichternde Weite der Lücke in der stark verbauten Stadt erlaubt. In Zeiten der multiplen Krise, wie sie u.a. Ulrich Brand beschreibt, wird auch hier der Logik des Kapitals gefolgt und die Stadt enger unter dem Druck spekulativer Finanzwetten.
Um solche Räume zu eröffnen und offen zu halten, reicht es nicht aus, zu kritisieren was gebaut und an wen zu welchem Preis verkauft wird – neben permanenteren Einrichtungen braucht es auch Menschen, Künstler*innen, Aktivist*innen, die Fenster und Türen in die unbebauten Räume der Stadt eröffnen – und sie anderen aufhalten. Für eine funktionierende, antiautoritäre Gemeinschaft braucht es die Begegnung, offene Orte, und die Möglichkeit ohne Barrieren in Austausch und gemeinsames Schaffen zu kommen.
Verbau
In vielen Diskursen ist die Kritik an übermäßiger Bebauung in Stadt und Land bereits angekommen. Doch werden Wohnungsnot, Stadtentwicklungspläne und ähnliche strukturelle Argumente oft als unausweichliche Begründung für weitere Bauprojekte dargestellt. Gleichzeitig zeigen Hausbesetzer*innen und politische Initiativen sowieErhebungen in vielen Städten, wie viel Wohnraum im Zeichen des Profits einfach dem Verfall überlassen, durch Zwangsräumungen zum Spekulationsobjekt gemacht, leer steht oder schlichtweg zerstört wird.
Zusätzlich wird der globale Wettbewerb zwischen Städten, zumindest aus ökonomischer Perspektive, als unerlässlicher Entwicklungsmotor gesehen. Es wird Infrastruktur für multinationale Konzerne, Mega-Sport-Events oder internationale Kulturfestivals geschaffen. Oft auf Kosten der direkten Nachbar*innenschaft. Ein aktuelles Beispiel aus Wien ist die geplante Wien Holding-Arena auf dem Areal des vormaligen Schlachthofs St. Marx im 3. Wiener Gemeindebezirk. Auch hier organisieren sich Anwohner*innen, Nutzer*innen und interessierte Menschen gegen ein Projekt, das Stadtraum ausbeutet, anstatt gemeinschaftliche Orte zu schaffen oder zu erhalten. In der Initiative „St. Marx für Alle“ protestieren sie gegen den Bau der neuen Eventhalle. Diesem müssten Gemeinschaftsgärten, ein DIY-Skateplatz, ein Basketballpatz und einer der größten verbleibenden Freiräume Wiens mit 40.000 m2 weichen. Müssten(!), wenn es nach den Vorstellungen von Investment-Firmen, Kapital und Stadtregierung ginge.
Doch die Bewohner*innen der Stadt organisieren sich nicht bloß, um gegen den Bau neuer Spekulationsobjekte aufzubegehren. Sie finden sich zusammen, um andere Formen des Zusammenlebens zu entwickeln, sich zu neuen Geweben zu vernetzen und so zumindest Teile ihres Alltags entgegen der Logik der Märkte zu bestreiten. Sie bauen Hierarchien entlang willkürlich gezogener, gesellschaftlicher Grenzen ab und arbeiten gegen Rassismus, Sexismus, Klassismus und Speziesismus an. Sie schneiden Fenster und Türen in die Zäune und Wände jener, die davon profitieren, dass die Grenzen als unausweichlich und undurchdringbar gelten. Sie wagen sich in die Brüche und Risse, die Einblick und Ausblick in die Durchschaubarkeit der ständig wiederholten Geschichten gewähren. Und bauen auf das Potenzial, eigene Geschichten zu erzählen – in der Hoffnung, dass sich etwas ändert. Die Brachflächen und Baulücken der Stadt sind dabei ein offenes Feld für Versuche und Experimente – für das Leben!
und Kunst
Die Ausstellung „building<against“ in der kex—kunsthalle exnergasse bringt Künstler*innen zusammen, die eine widerständige räumliche Praxis verfolgen oder für eine andere Stadt eintreten. Zusammen mit den Besucher*innen wird mit (Bau-) Stoffen experimentiert, gemeinsam gebaut, und es werden eigene Geschichten rund um die utopische Stadt geschrieben. Der Austausch soll auch Momente der Selbstermächtigung ermöglichen.Als Teil der Ausstellung wird auch ein Aneignungswagen gebaut, der an eine Protestbewegung übergeben wird – an diejenigen, die tagtäglich ihre freie Zeit nutzen, um sich für andere und gegen die Zerstörung und Ausbeutung des Lebens einzusetzen.
- building < against
Mi 24.9. bis Sa 25.10.2025, kex—kunsthalle exnergasse
Eröffnung: Di 24.9.2025 18.00 Uhr