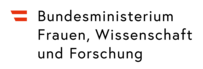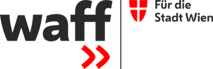Noch warm im Kern
Lesezeit: ca. 9 Minuten
Als ich am Abend des 21. Oktobers die in herbstige Frische getauchten Backsteinfassaden des Wiener WUK hinter mir ließ, konnte ich nicht anders als an Brot zu denken. Einige Stunden saß ich an charmant gedeckten Tischen mit eloquenten Menschen, die sich mit Leidenschaft den Kopf über politischen Wandel zerbrachen. Die ihren tiefen Unmut über die aktuellen demokratischen Schieflagen mitbrachten und ihn mit hoher Motivation garnierten, jene Schieflagen gemeinsam wieder gerade zu rücken. Nicht als Tisch. Nicht dieser Raum. Die Netzwerke in Forschung, Gemeinnützigkeit, Sozialdienstleistung und Menschenrechtsarbeit, zu denen der Tisch Zugang hat. Ein Potpourri an Expertise speiste sich aus den Dialogen und obwohl die Teller voller bunter Beilagen und saftiger Aromen waren, dachte ich an Brot. Brot als etwas Urtümliches. Etwas, das zusammenbringt. Etwas gegen die zehrenden Stunden. Ein menschliches Grundbedürfnis. Von fleißigen Händen in Form gebracht und in der Hitze zum Leben erweckt. Außen widerstandsfähig und innen umarmend weich.
Vielleicht – dachte ich, als ich an der Volksoper vorbei Richtung U6 spazierte – vielleicht sind NGOs ein bisschen wie Brot. Nicht spektakulär, nicht glamourös, kaum je Mittelpunkt eines Festmahls, und doch das, was bleibt, wenn all die Glasuren, Reden und Dekorationen abgeräumt sind. Brot schmeißt man nicht leichtfertig weg. Man erwartet, dass es nährt, auch wenn die Zeiten hart werden. Vielleicht gerade dann. Brot verkehrt in angesehenen Kreisen und kann sich für edle Anlässe schick machen. Brot kann aber auch bodenständig, rustikal und nahbar sein. Brot kommt in Paläste und in Heurigen, auf Silbertableaus und Jausenplatten, Brot kennt Trüffelbutter und Grammelschmalz. Brot ist ein Klassenkonnex – und man sollte Brot nie für erkaltet erklären, nur weil es von außen manchmal versteinert wirkt.
Selten haben die Umstände eines Auftrags sich so brutal in die Metaphorik meines Schreibens eingebacken. Selten hat es sich so corny angefühlt. Nie war es dennoch so stimmig. Und dabei hat der Abend in dieser Nacherzählung noch nicht einmal begonnen.

Gesellschaften sind Erzählmaschinen. Sie weben Geschichten, verteilen Rollen, erschaffen Kategorien und verkünden Wahrheiten, als wären sie unumstößlich. Demokratie ist eine dieser großen Erzählungen. Ehrwürdig, vielfach zitiert, unvollendet. Sie beginnt mit dem Versprechen der Gleichheit, doch oft endet sie mit der Ernüchterung darüber, wer tatsächlich sichtbar wird. Demokratie funktioniert nicht durch Mehrheiten allein. Sie funktioniert durch die Geschichten, die Mehrheiten formen. Wenn die Fäden dieser Geschichten einseitig gesponnen sind, zieht sich das Gewebe zusammen. Und genau das erleben wir: weltweit, in Europa, in Österreich. Autoritäre Tendenzen wachsen nicht, weil plötzlich die Sehnsucht nach Diktatur erwacht ist, sondern weil die dominanten Erzählungen verblassen – und andere sie ersetzen.
Populismus wiederum ist kein Zufallsprodukt der Demokratie. Er ist das Symptom einer politischen Grammatik, die Unbehagen nicht ernst nimmt, sondern instrumentalisiert. Er entsteht dort, wo marginalisierte Perspektiven nicht mitgedacht werden. Und er gedeiht dort, wo gesellschaftliche Institutionen die Repräsentation jener, für die sie sich einsetzen, übersehen, vergessen, missachten. Was die Politik übersieht, muss die Zivilgesellschaft in Licht stellen. Das tut sie. Organisiert. Im ständigen Wechselspiel zwischen Korrektiv und Duldung. So die Prämisse. Man bitte die Diskutant*innen an die Tische.
Mit vier Impulsen zu vier Gängen an vier Tischen versprach diese Ausgabe von „Demokratie am Tisch“ einen reichhaltigen Schmaus für Hirn, Herz und Magen. Über Auftrag und Haltung würden wir hören und reden, über Organisationen im Spannungsfeld zwischen Dienstleistung und politischer Stimme, zwischen ethischer Treue und finanzieller Abhängigkeit. Als die Politologin und Erwachsenenbildnerin Margit Appel den ersten Gesprächsgang kredenzte, war ihr Ton kritisch, aber gefasst. Er war analytisch, fast sachlich. Doch gerade diese Sachlichkeit machte deutlich, wie prekär die Lage ist. NGOs beschrieb sie als Demokratieverstärker, die soziale Themen bewirtschaften und sich in ständigen Widersprüchen wiederfinden. Sie füllen jene Räume, die politische Systeme ausdünnen, und werden gleichzeitig dafür kritisiert, eben diese Räume zu benennen. Appel zeichnete das Bild eines demokratischen Teilsystems, das das andere kolonisiert. Politik, die Aufgaben an NGOs delegiert, aber ihre Kritik nicht duldet. Ein Staat, der Hilfe braucht, aber keine Haltung. Ein Land, in dem die demokratischen Normen bröckeln, während jene, die ihre Erosion sichtbar machen, an den Rand gedrängt werden. Eine erste rhetorische Kostprobe mit bittersüßen Komponenten.
Am ersten Tisch begann das Reden zaghaft, wie ein kollektives Ausatmen nach Jahren, in denen niemand Zeit für Pausen hatte. Schnell lag das Wort „Selbstausbeutung“ zwischen uns. Nicht als Vorwurf, sondern als vertrauter Begleiter einer Arbeit, die größer ist als die Menschen, die sie tragen. Erschöpfung war hier kein Ausnahmezustand, sondern ein stiller Taktgeber. Dann kam der finanzielle Druck zur Sprache: Förderlogiken, die mehr auf Nachweise als auf Wirkung schauen; Projektlaufzeiten, die nicht zu Lebensrealitäten passen; das Gefühl, gleichzeitig demokratische Infrastruktur und abrufbare Antragsschreiber*innen zu sein.
Natürlich spürte man auch den Druck von rechts. Gezielte Angriffe, die NGOs zu Feindbildern stilisieren, als könne man durch Diffamierung verhindern, dass Ungerechtigkeit sichtbar wird. Doch mindestens ebenso schmerzte die Einsicht, dass es auch nach links Brüche gibt: Räume, die inklusiv sein wollen, aber oft nur jene erreichen, die die gleiche akademische Sprache sprechen. Menschen, die man vertreten will, aber nicht erreicht. Eine erste Nuance von radikaler Selbstkritik kitzelte am Gaumen, blieb aber noch sanft im Abgang.

Der zweite Gang wurde eröffnet von Mona Aglan. Als Beraterin für Orient Express in Wien, eine existenzielle Anlaufstelle für junge Frauen und Mädchen, weiß auch sie von den Gleichzeitigen in der Gemeinnützigkeit zu berichten. Aglan sprach mit einer Klarheit, die den Raum kurz schwerer machte. Sie erinnerte daran, dass NGOs nicht im luftleeren Raum arbeiten, sondern in einem Geflecht aus Erwartungen, Förderrichtlinien und politischen Stimmungen. Dass Abhängigkeit nicht nur finanziell ist, sondern auch sprachlich, kulturell, strukturell. Sie zeigte auf eine Spannung, die viele kennen, aber kaum jemand benennt: Wie leicht jene marginalisiert werden, die eigentlich gestärkt gehören. Manchmal auch durch die eigenen Rahmenbedingungen. Ebenso sprach sie von schmerzhaft schweren Entscheidungen im Opferschutz, wenn einer Klientin etwa davon abgeraten wird, sich aus schädlichen familiären Umständen zu lösen, weil das mit einer Abschiebung verbunden wäre. Staatliche Gewalt als Strafe für Resilienz quasi. Ihr Beitrag war eine wichtige Verschiebung der Perspektive. Eine Erinnerung an die Grenzen des Bewusstseins einer vornehmlich weißen Gesellschaft. Und daran, dass diese Grenzen häufig dort beginnen, wo die Mehrsprachigkeit der Lebensrealitäten endet.
Am darauffolgenden Tisch rückte das Gespräch näher an die alltägliche Praxis heran. Jemand sprach vom „Dilemma der Finanzierung“, und sofort nickten viele, als wäre ein gemeinsamer Nenner gefallen. Man diskutierte über Kurse, Integrationslogiken, über Erwartungen, die an Menschen gestellt werden, bevor sie überhaupt ankommen dürfen. Hinter all dem schwang die Frage: Wie viel Formbarkeit verlangt ein System, das sich selbst kaum bewegt? Zwischendurch fiel ein Beispiel aus der Politik: die kürzlich gesenkte Mindestsicherung für subsidiär Schutzberechtigte. Niemand musste erklären, was das bedeutet. Die Blicke reichten. Ein Thema kehrte immer wieder zurück, fast unbemerkt: Sprache. Welche Worte wir wählen, und welche Realitäten wir damit bauen. Ob wir Begriffe reproduzieren, die Distanz erzeugen, oder solche, die Verbindung stiften. Die fehlende Mehrsprachigkeit – nicht nur in der Ausführung, auch in der Struktur – lag laut über dem Tisch, ohne direkt ausgesprochen zu werden.
Im Raum kristallisierte sich der Wunsch nach Integrität – nicht als moralische Pose, sondern als tägliche Praxis. Und wir trennten uns vom zweiten Tisch mit der Frage, ob Zuhören manchmal die radikalste Form von Intervention ist. Und ob man erst im Zuhören merkt, wie viele Stimmen noch fehlen.

Den Beginn der zweiten Hälfte des Abends sollte Stefan Wallner servieren. Als ehemaliger Caritas Generalsekretär und abgedankter Grüner weiß er wie kaum ein Zweiter um die spannungsgeladene Arbeit der NGOs. Er begann mit einem scheinbar einfachen Satz: „Ohne NGOs wird es schwer.“ Kein Pathos. Eine Feststellung mit sehr ernsthaftem Unterton. Er sprach über Vertrauen als Grundlage jeder demokratischen Infrastruktur. NGOs, sagte er, seien Orte, an denen Menschen ihr Vertrauen ablegen, weil sie wissen, dass dort Bedürfnisse gesammelt, Ungerechtigkeiten benannt und Schutzräume geschaffen werden. Doch was passiert, wenn jene Institutionen, die als moralischer Kompass gelten, selbst in die Vertrauenskrise geraten?
Wallner sprach über Autoritarismus. Darüber, wie antidemokratische Tendenzen regelbasierte Strukturen nicht einfach schwächen, sondern aushöhlen. Und darüber, dass die stärkste Waffe rechter Bewegungen nicht der Angriff selbst sei, sondern die Kontrolle darüber, wie wir über Angriffe sprechen. Message Control, sagte Wallner, ist keine Strategie – es ist ein System. Ein System, das Deutungshoheit verschiebt, Zustände normalisiert und Zweifel sät.
Am letzten Aspekt arbeiteten wir uns auch am Tisch ab. Es ging um Reichweite: Über welche Kanäle erreicht man Menschen, die nicht ohnehin zuhören? Über welche Stimmen werden Solidarität und Unterstützung mobilisiert? Und wer steht am Ende tatsächlich auf, wenn Kürzungen drohen oder Rechte agieren? All das als Balanceakt in einem Gemenge, in dem NGOs am Ende des Tages oft in Konkurrenz zueinanderstehen – um Aufmerksamkeit, Ressourcen und Räume. Abgerundet wurde dieser Gang durch die Frage, wie fragil NGOs intern sein können, selbst wenn sie nach außen Souveränität demonstrieren. Fälle wie der von SOS Kinderdorf zeigen, wie stabil etwas von außen wirken kann, während innere Brüche zu spät sichtbar werden. Es blieb uns ein gemeinsames Abwägen: Wie wird man effektiv und integer, während man gleichzeitig Verbindung hält – zu den Menschen, die man vertreten will, und zu den Kolleg*innen im Feld?

Den Abschluss des Abends verköstigte Philipp Sonderegger. Der Menschenrechtler, NGO-Berater und einstige Sprecher von SOS Mitmensch tat etwas, das der demokratischen Debatte oft fehlt: Er rehabilitierte den Streit. Nicht jenen Streit, den die Rechte inszeniert – laut, polemisch, spaltend –, sondern den produktiven Dissens. Er erinnerte daran, dass Demokratie ohne Konflikt nicht nur langweilig wäre, sondern unmöglich.
Sonderegger wies außerdem auf die Hegemonien im Diskurs hin, auf die Mechanismen, die bestimmen, welche Stimmen dominieren und welche verdrängt werden. Die Stimmung mag kritisch wirken, sagte er, doch das sei nicht neu – sie sei Teil des ständigen Abwägens zwischen Anspruch und Praxis. Wer Veränderung will, muss Dissens aushalten und selbstkritisch bleiben. Ein besonderer Hinweis galt Grassroots-Bewegungen. Dort, an den Rändern der Systeme, entstehen oft Initiativen, die institutionelle Strukturen längst verpasst haben: kreative Lösungen, neue Perspektiven, politische Innovationen. Sondereggers Worte erinnerten daran, dass NGO-Arbeit nicht nur in professioneller Expertise, sondern auch in der Aufmerksamkeit für neue Praxen lebt.
Am vierten und letzten Tisch drehte sich das Gespräch um die Balance zwischen Notwendigkeit und Realität. Lange verharrten wir bei einer zynischen Tatsache: NGOs benötigen Krisen, um sichtbar und wirksam zu sein. Ohne die drängenden Themen – Femizide, Vertreibung, soziale Ungleichheit – würde vieles an Förderungen und Aufmerksamkeit fehlen. Wir sprachen über Widersprüche, die das mit sich bringt und die Sinnfrage, die sich viele stellen. Darüber, dass politische Stimmung und soziale Dienstleistungen sich wechselseitig bedingen. Darüber, dass Gesetze oft nötige Weiterentwicklung blockieren und darüber, wie absurd es sei, dass der Neoliberalismus mittlerweile Profitunternehmen in Aufgaben der Gemeinnützigkeit bringt – oft an der Grenze dessen, was sinnvoll ist.

Am Ende des Abends blieb ein Gefühl, das schwer zu greifen ist: Wärme, die nicht aus der Hitze eines Moments, sondern aus Beständigkeit entsteht. Wie das Brot, das mir in Verbindung mit dem Abend in den Synapsen rumknuspert, sind NGOs nicht immer glanzvoll, aber notwendig. Sie halten zusammen, nähren Diskurse, tragen Verantwortung, selbst wenn die Strukturen, in denen sie wirken, brüchig sind. Sie sind ein Fundament, das spürbar wird, wenn es fehlt.
Gleichzeitig gärte in mir ein ungestilltes Bedürfnis. Die Sehnsucht nach einem Wort, das an den Tischen nicht fiel, aber elementar scheint: Repräsentation. So enorm bewandert die Tische in ihrer Zusammensetzung waren, so wenig divers blieben sie. In den Entscheidungsposten vieler NGOs sitzt bis heute eine Demografie, die von den Problemen, denen sie sich widmet, selten betroffen ist. Muss ich Armut kennen, um mich gegen sie stark zu machen? Natürlich nicht. Sollte ich Rassismus erfahren haben, um Anti-Diskriminierungsarbeit zu leisten? Nicht per se. Aber es hilft dem Verständnis von Bedürfnissen und dem Umgang mit marginalisierten Gruppen, wenn das Wissen über Betroffene nicht nur erlernt wird, sondern in der Mitte des Wirkens als Selbsterfahrung präsent ist. Wenn Betroffene nicht nur Empfänger*innen sind oder die letztliche Arbeit vor Ort ausführen – sondern wenn sie die Konzepte schreiben. Die Budgets kalkulieren. Die Projekte planen. Wenn sie mit am Tisch sitzen. Mein Austausch im Anschluss an die vier Gänge schloss sich dem Fazit an. Neben der Dankbarkeit für dieses wichtige Format und der Bewunderung für das unermüdliche Engagement aller Beteiligten, blieb auch hier ein kleiner Hunger nach einem internen Hinterfragen.
John Evers vom Verband Österreichischer Volkshochschulen erinnerte daran, dass Kritik nicht nur nach außen gerichtet sein darf. Es sei ebenso wichtig, die eigenen Strukturen zu reflektieren, Integrität und Haltung und letztlich die eigenen Rollen zu prüfen. „Nicht nur mit dem Finger nach außen zeigen, sondern auch nach innen schauen,“ sagte er. Die Demokratie am Tisch beginne immer mit der Bereitschaft zur Selbstkritik.
Girishya Stella Kurazikubone vom aktivistischen Filmkollektiv Triangle Studios lenkte den Blick auf die Stimmen, die oft ungehört bleiben. Sie betonte, wie entscheidend es sei, Kompetenzen aus Grassroots-Initiativen einzubinden – jene, die schon lange praktische Lösungen schaffen, bevor sie formal anerkannt werden. Gleichzeitig kritisierte sie die fehlende Sensibilität in der Sprache, wenn etwa überholte Begriffe wie „Flüchtlinge“ von Leitungsfunktionären in der Arbeit mit Vertriebenen am Tisch fallen. Ihr Appell war klar: Mehr Diversität, mehr Gleichstellung, mehr Sichtbarkeit für die Personen, um die es eigentlich geht. Nicht die Expert*innen allein, auch die Betroffenen selbst sollten ins Spotlight rücken.
Ganz gewiss wohl genährt in allen Belangen trug es mich jenes Abends nach Hause. Mit einer Mischung aus Wertschätzung, kritischer Anerkennung und radikalem Optimismus. Die Gespräche und Reflexionen, die Impulse und Diskurse – all das bleibt wertvoll. Wenn wir es jetzt noch schaffen, an der Vielfalt der Perspektiven und Verantwortlichen zu arbeiten, wird daraus nachhaltige Stärke. Auch wenn dem Brotregal der NGO-Szene eine neue Rezeptur guttäte, spürt man bei jedem Bissen: Da ist Substanz, da ist Sauerstoff, da ist Robustheit – und vor allem ganz viel Wärme.

Text: Jonas Scheiner ist Schriftsteller, Kulturkonzepter und Mitbegründer des Wiener Jugendprojekts „Demokratie, was geht?“, das mit jungen Menschen an der Schnittstelle von Kunst und Aktivismus neue Formen von gesellschaftlicher Teilhabe entwickelt.
Bei „Demokratie am Tisch“ war er als teilnehmender Beobachter eingeladen, mitzuessen, mitzureden und danach darüber zu schreiben.
Organisationen im Spannungsfeld zwischen Dienstleistung und politischer Stimme
Vier Gänge, vier Impulse und vier Tische: Gemeinsam essen, miteinander ins Gespräch kommen, sich vernetzen, gemeinsame Perspektiven finden. Zu jedem Gang des servierten Dinners wird von eingeladenen Expert*innen ein spannender Impuls zum Thema geliefert, der als Ausgangspunkt für anregende Diskussionen zwischen den Gängen dient.
Gastgeber: Christoph Trauner (WUK) und Martin Wurzenrainer (Integrationshaus)
Mit Impulsen von:
- Margit Appel, Politologin und Erwachsenenbildnerin
- Mona Aglan, Beraterin und Betreuerin bei Orient Express – Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen
- Stefan Wallner, Geschäftsführer des Bündnis für Gemeinnützigkeit
- Philipp Sonderegger, unabhängiger Menschenrechtler und freiberuflicher Berater für zivilgesellschaftliche Organisationen
Kulinarik: HLTW Bergheidengasse
WUK Radio
Sarah Roland von WUK Radio hat “Demokratie am Tisch #3 - Auftrag und Haltung” mit Interviews und Mitschnitten der Impulse begleitet.