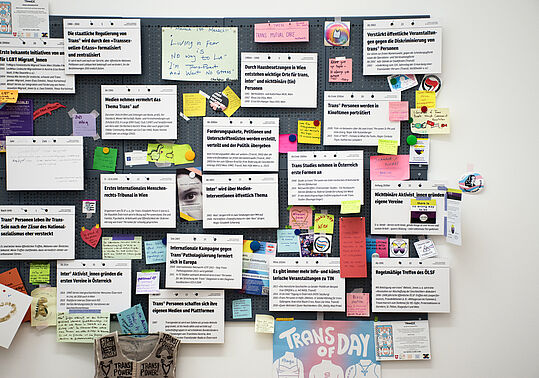Eco Criminials! Justitia!
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Ihr seid seit Jahren in der Klimabewegung aktiv. Was hat euch dazu gebracht, euch auf Straßen, vor Gerichten oder nun auch auf einer Bühne zu positionieren?
Lorenz: Durch mein Studium habe ich viel über gescheiterte Klimapolitik gelernt. Dabei kam sehr viel Frust und Wut auf. Ich wollte meine Verantwortung als privilegierter Mensch wahrnehmen und wirksam werden. Es hilft mir auch mental, meine Stimme und meinen Körper aktiv gegen diese humanitäre Katastrophe einzusetzen.
Florian: Im Sommer 2022, als die Letzte Generation aktiv wurde, hab ich zum ersten Mal die Musik von Sigi Maron gehört und Lust auf Rebellion bekommen. Die Straßenblockaden waren sehr wirksam. Und die Leute, die ich da kennengelernt hab, waren interessant. Das war eine gute Zeit.
Martha: Dass wir Menschen die Erde aufheizen, habe ich schon in der Schule gelernt, aber das existenzbedrohende Ausmaß des Problems wurde mir erst bewusst, als ich mich tiefer in die wissenschaftliche Literatur eingelesen habe. Weil jeder andere Protest immer nur ausgesessen und ignoriert wurde, haben wir damals die Letzte Generation gestartet. Es war ein Versuch, unsere Verzweiflung unübersehbar zu machen. Zum Teil ist das auch gelungen. Das eigentliche Ziel, unsere Gesellschaft rechtzeitig vom Selbstzerstörungskurs abzubringen, haben wir aber nicht erreicht.
Vor Gericht sitzen meist Aktivist*innen, nicht Konzerne. Wie habt ihr es erlebt, selbst angeklagt oder kriminalisiert zu werden? Haben diese Erfahrungen auch euer Vertrauen in die Demokratie erschüttert?
F: Nein, im Gegenteil. Es gab nur einen einzigen Richter, der wirklich unfair war und sein Urteil wurde vom Verwaltungsgerichtshof gekippt. Unsere Justiz funktioniert gut. Aber wenn die ganze Gesellschaft etwas nicht verstehen will, helfen auch keine Gerichtsurteile.
L: Vor Gericht gab es bestärkende Momente, aber auch Frustration. Kriminalisiert zu werden fühlt sich teilweise absurd an, vor allem wenn Repressionen unverhältnismäßig sind. Es hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, die Demokratie zu stärken und weiterzuentwickeln.
M: Studien aus Deutschland und den USA belegen, dass die Meinung von Menschen mit mittleren Einkommen keinen messbaren Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung hat. Für Geringverdiener*innen findet sich in der deutschen Studie sogar ein „negatives Stimmgewicht“, d.h. je mehr sie eine bestimmte Gesetzesänderung wollen, desto weniger wahrscheinlich wird diese beschlossen. An die Demokratie an sich, also die Herrschaft der Bevölkerung, glaube ich fest, aber nicht mehr an Wahlen als geeignetes demokratisches Mittel. Bei den alten Griechen war die Demokratie mit dem Losverfahren verknüpft, um allen Bürger*innen die gleiche Chance auf Teilhabe zu geben. Der Klimarat hat gezeigt: Demokratie nach dem Losverfahren könnte auch in der heutigen Zeit Lösungen liefern.
Um umweltpolitische Unterdrückung und Machtungleichheit beschreiben zu können und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass nicht alle gleichermaßen von der Klimakrise betroffen sind bzw. dazu beitragen, hat sich der Begriff der „Klima(un)gerechtigkeit“ etabliert. Wo begegnet euch diese Ungerechtigkeit am deutlichsten? Und welche Stimmen fehlen am meisten im öffentlichen Diskurs?
F: Bei den kleinen Kindern. Ich bin Onkel. Die Kinder haben überhaupt nichts zu dem Schlamassel beigetragen. Das macht mich sehr traurig.
M:
Die, die den Schaden anrichten, müssen ihn nicht bezahlen. Die, die für den Schaden bezahlen, haben ihn nicht angerichtet.
Ungerechter geht es kaum. Unser Diskurs ist geprägt von den mit viel Werbe-Geld verstärkten Stimmen der Zerstörer*innen, während Opfer kaum zu Wort kommen.
L: Die Auswirkungen der Klimakrise sind am stärksten im globalen Süden. Es sterben bereits jetzt unvorstellbar viele Menschen daran. Der globale Norden hat nicht nur weitaus mehr Emissionen in die Atmosphäre geblasen, sondern durch die koloniale Geschichte und die wirtschaftliche Unterdrückung und Ausbeutung vieler Länder eine historische Verantwortung, die er aber kaum wahrnimmt.
In den letzten Jahren haben sich sog. „Klimakollaps Cafés“ entwickelt. Was kann man sich darunter vorstellen und wie helfen sie, sich gemeinsam auf die Klimakrise vorzubereiten?
M: Das Klima entwickelt sich rapide in Richtung eines Worst-Case-Szenarios und es gibt eigentlich keinen realistischen Weg mehr, den Totalschaden abzuwenden. Das müssen wir uns eingestehen.Kollaps Cafés bieten einen Raum, sich mit anderen, die zu demselben Schluss gelangt sind, darüber auszutauschen.
F: Sich ständig einzureden, dass alles irgendwie gut wird, ist anstrengend. Und die unterdrückten, verdrängten Zukunftsängste sind ungesund für die Psyche. Besser ist es, ehrlich damit umzugehen. Das ist alleine sehr schwer, gemeinsam viel leichter.
L: Die Kollaps Cafés helfen dabei, in einem safer space Sorgen und Ängste zu teilen sowie Antworten auf Fragen zum Kollaps zu finden.
Lorenz und Florian, ihr arbeitet auch beide im Bereich der Gemeinwohl-Ökonomie. Was ist unter dem Begriff zu verstehen und wie kann dieses Modell Antworten auf die Klimakrise geben und demokratische Strukturen fördern?
L: Die Gemeinwohl-Ökonomie ist eine internationale Bewegung, die das Wirtschaften auf das Gemeinwohl anstatt auf Profit und Wachstum ausrichtet. Es sollte finanzielle Vorteile geben, sozial-ökologisch zu wirtschaften. Derzeit haben Unternehmen, die skrupellos Mensch und Umwelt ausbeuten, weitaus bessere Karten. Die Klimakrise ist ein Symptom dieser Ausbeutung. Das endlose Wachstum zu beenden würde dabei helfen, ökologische Krisen zu begrenzen und ein würdevolles Zusammenleben zu ermöglichen.
Aber es geht auch um eine Demokratisierung der Wirtschaft – in Unternehmen in Form von Mitbestimmung der Mitarbeitenden, in Gemeinden und Staaten durch partizipative Entscheidungsfindungen. Wir organisieren gerade Pilotprojekte, die demokratisch in Bürger*innenräten entwickelte Alternativen zum Bruttoinlandsprodukt etablieren und erproben. Wohlstand muss an qualitativen Kriterien gemessen werden und darf nicht länger mit dem rein monetären Wachstum gleichgesetzt werden.